Deep Research - Mit gezielter KI-Recherche ganz neu durchstarten
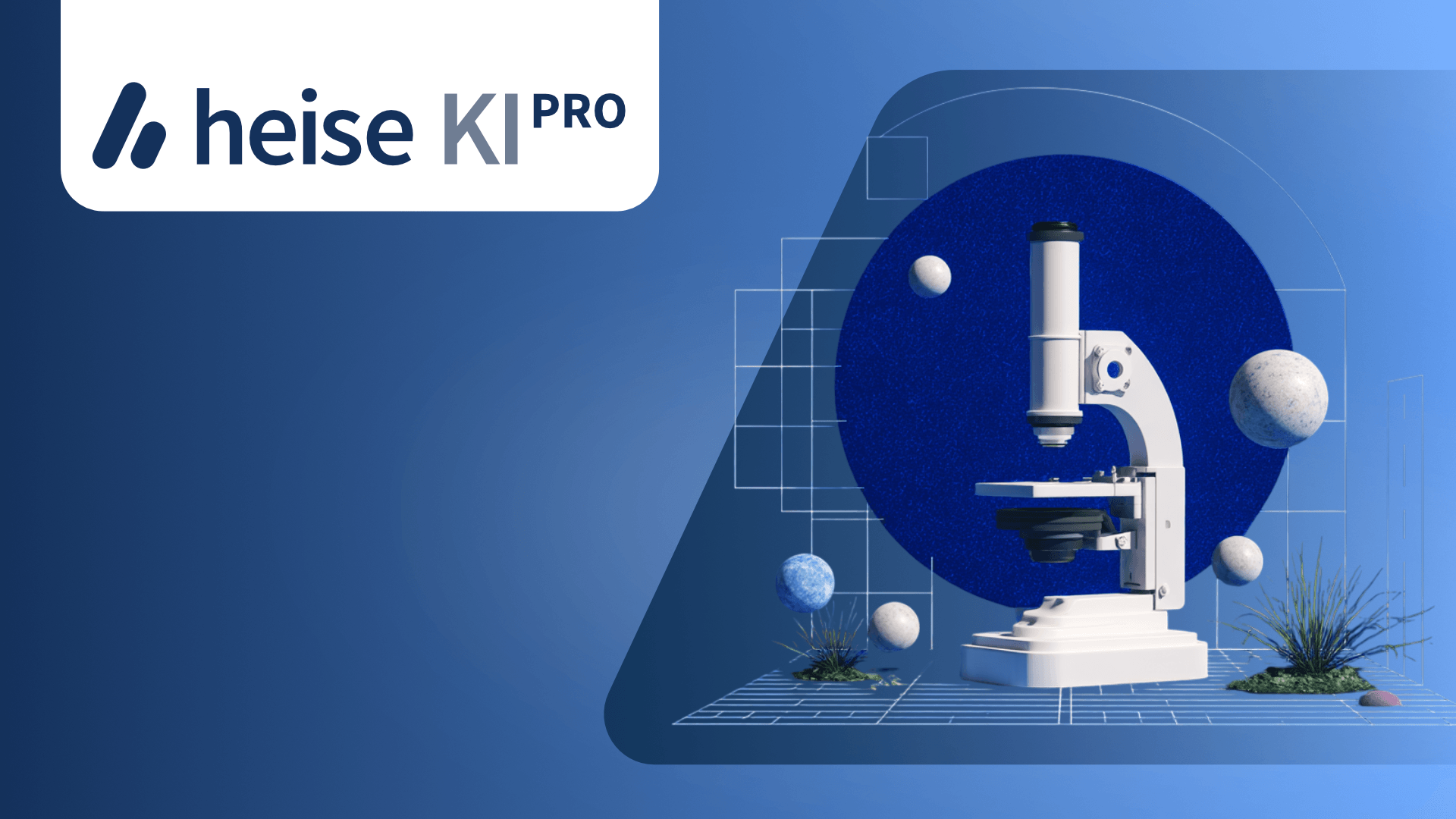
KI PRO
Einleitung: Wie „Deep Research“ Recherche verändert
Konventionelle KI-Chatsysteme sind primär auf schnelle Antworten und die Unterstützung bei überschaubaren konkreten Fragen ausgelegt. Für umfangreichere Recherchen, Analysen und Reports stehen inzwischen sogenannte „Deep-Research-Systeme“ (DR-Systeme) bereit. Diese arbeiten wie eigenständige Analysten: Sie recherchieren selbstständig aktiv im Internet, werten mehrere Quellen aus und ziehen eigenständig Schlussfolgerungen. Das Ergebnis sind ausführliche, ausformulierte Berichte, die als Grundlage für fundierte Entscheidungen dienen können. Das erste eigene Deep-Research-System kündigte OpenAI im Februar 2025 vollmundig an: „Es schafft in wenigen Minuten, wofür ein Mensch viele Stunden benötigen würde.“
heise KI PRO
KI VERSTEHEN UND ANWENDEN
- Alle Leistungen aus The Decoder inklusive.
- heise+ inkl. Pur-Abo – werbe- und trackingfreies Lesen (Wert > 200 €).
- Kostenloser Zugang zu allen Online-Events.
- Direktzugriff auf exklusive KI-Lerninhalte (z. B. KI-SEO, Prompt Engineering).
- Zwei KI-Business-Briefings pro Monat – kompakt und umsetzungsorientiert.
- Monatlicher PROTalk mit Redaktion und Expert:innen.
- Exklusiver KI-PRO-Community-Feed und WhatsApp-Gruppe – direkter Austausch mit Redaktion und Community.
- 1× KI-Tool heise I/O inklusive 30 € Startguthaben.