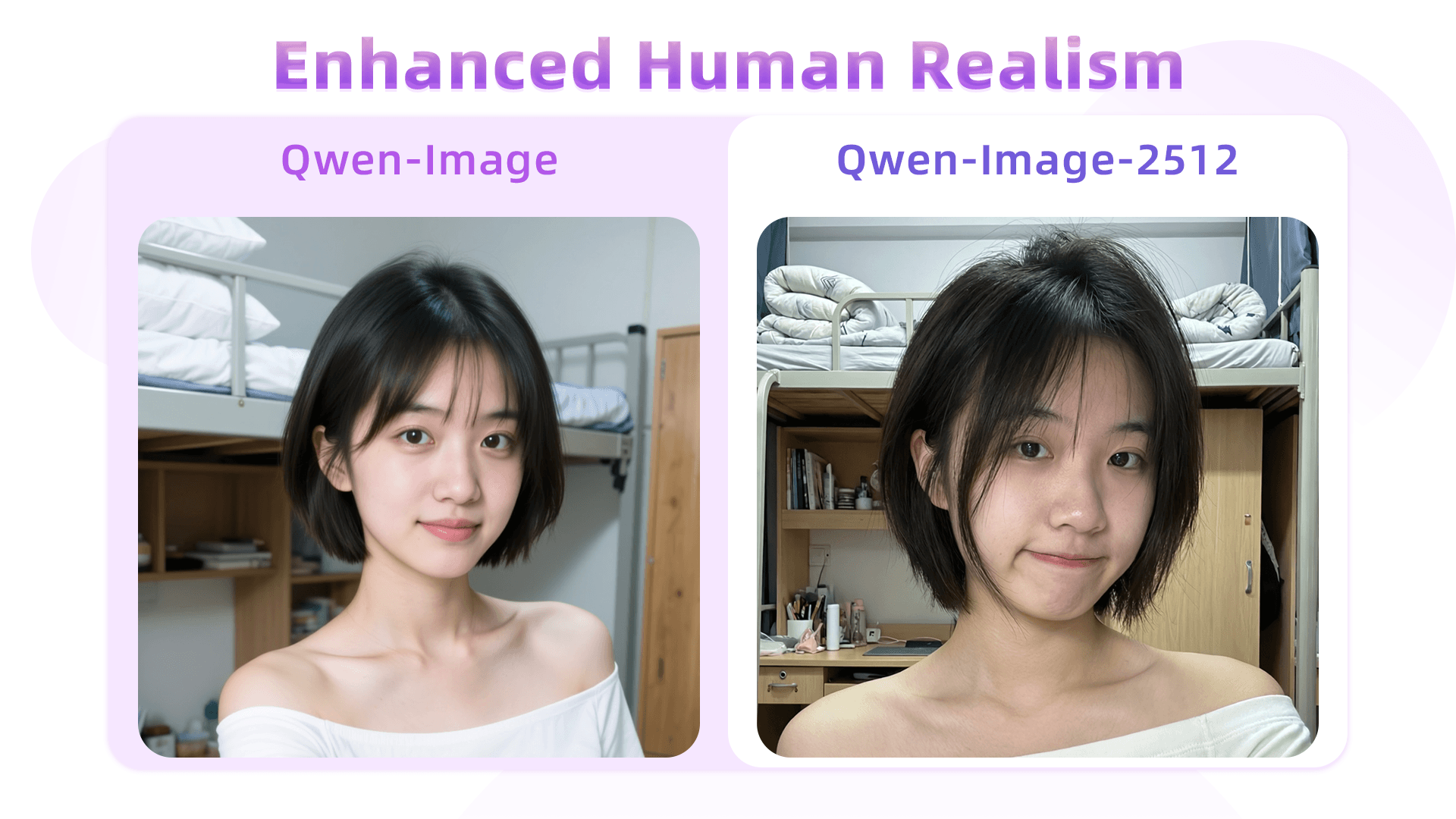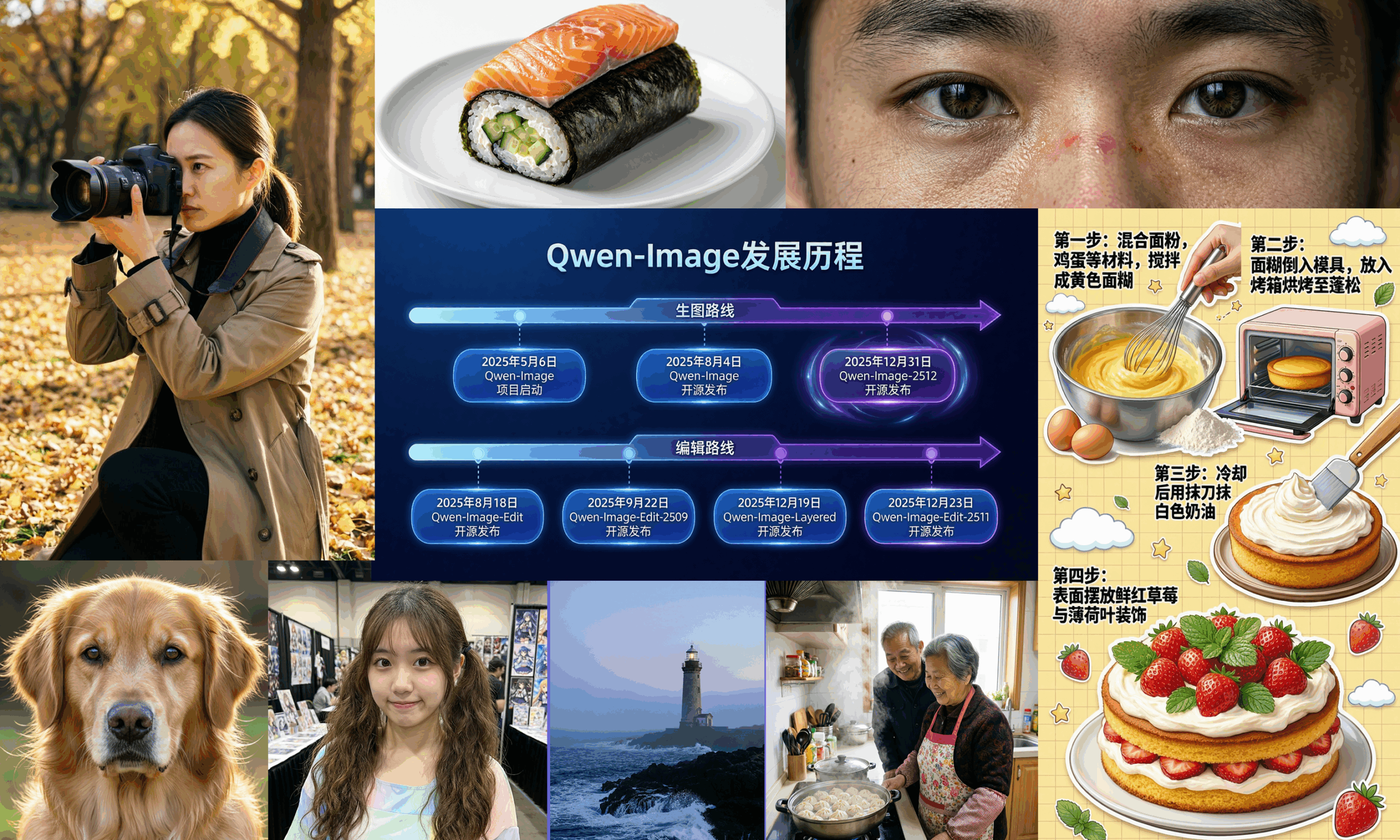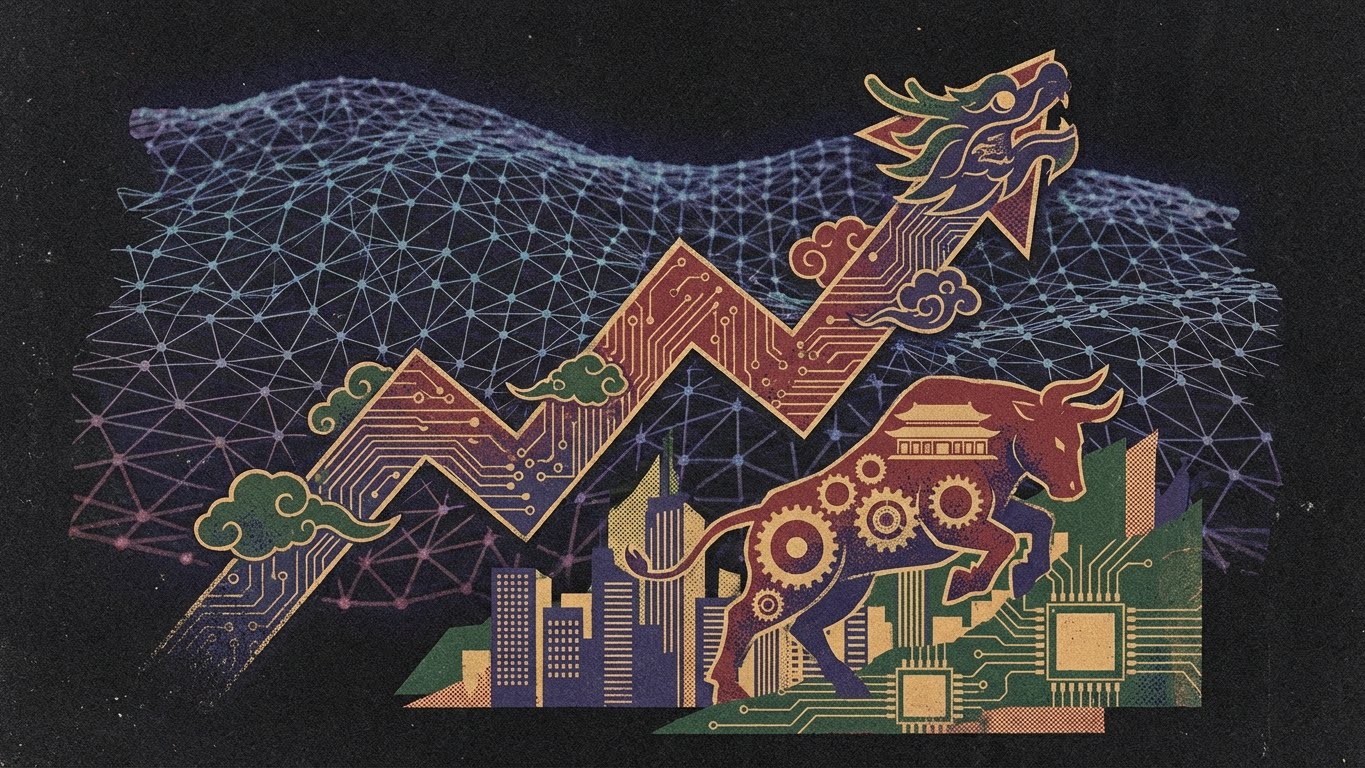OpenAI will, dass man sich mit der geplanten ChatGPT-Hardware primär unterhält. Das Unternehmen arbeitet daher an der Verbesserung seiner Audio-KI-Modelle, berichtet The Information. In den vergangenen zwei Monaten hat OpenAI mehrere Teams zusammengelegt, um die Audio-Modelle zu verbessern.
Derzeit hinken die Audio-Modelle den textbasierten Modellen bei Genauigkeit und Antwortgeschwindigkeit hinterher, so aktuelle und ehemalige Mitarbeitende. Eine neue Audio-Modell-Architektur soll natürlicher und emotionaler klingen, genauere Antworten liefern und gleichzeitig mit dem Nutzer sprechen können. Die Veröffentlichung ist für das erste Quartal 2026 geplant. Kundan Kumar, ein von Character.AI abgeworbener Forscher, leitet die Bemühungen.
Die eigentliche Hardware dürfte jedoch noch auf sich warten lassen. OpenAI plant angeblich mehrere Geräte, darunter Brillen und einen smarten Lautsprecher ohne Bildschirm. Für die Entwicklung kaufte OpenAI im vergangenen Jahr die Firma io des ehemaligen Apple-Designers Jony Ive für fast 6,5 Milliarden Dollar. Die große Vision hinter der Hardware dürfte die Etablierung eines "Super-KI-Assistenten" sein, der im Alltag mindestens so allgegenwärtig wie das Smartphone ist.