Zuckerberg: Wer künftig keine KI-Brille trägt, wird einen "kognitiven Nachteil" haben
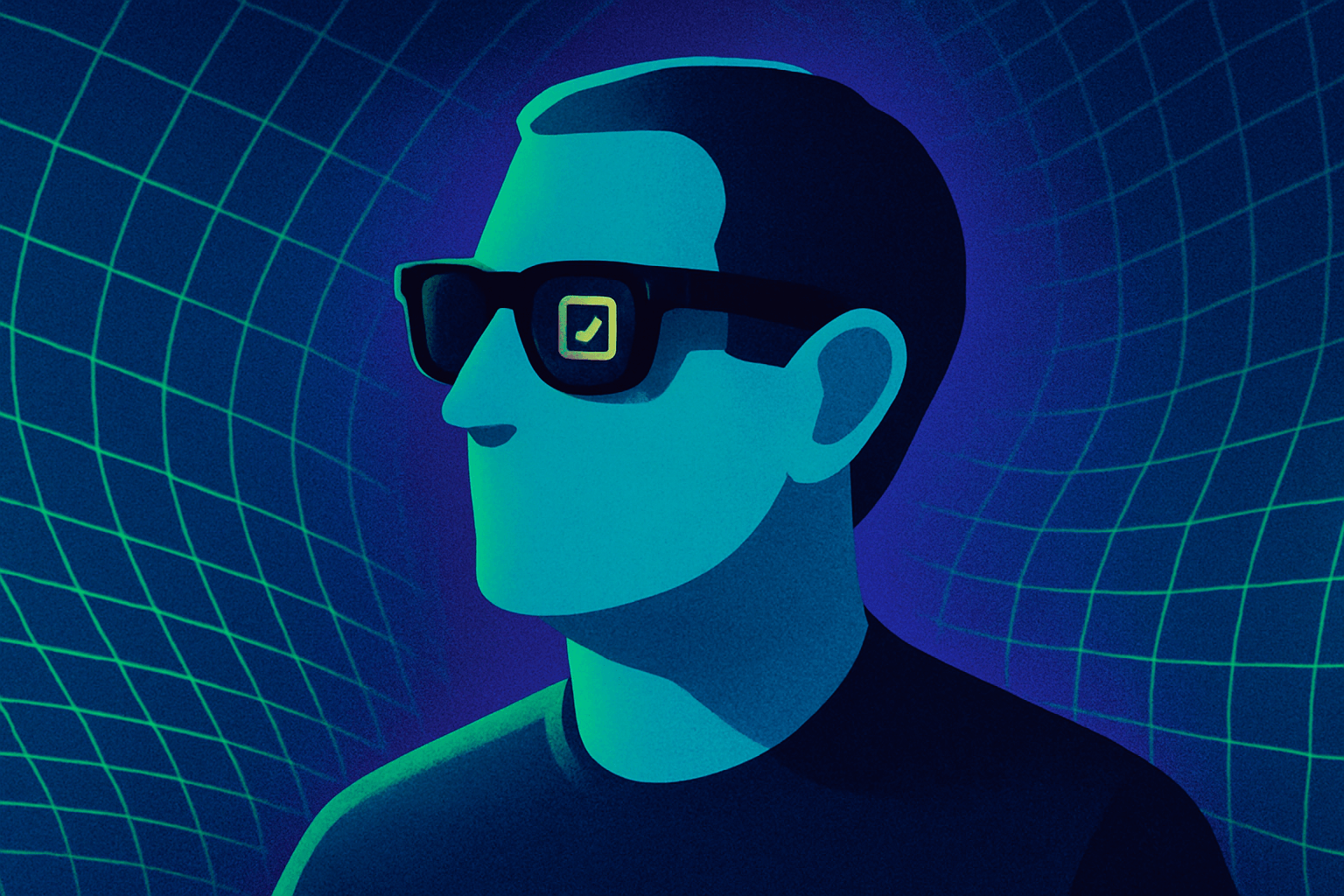
Meta-CEO Mark Zuckerberg setzt bei Künstlicher Intelligenz auf ein anderes Ziel als viele Wettbewerber: Statt zentralisierter Systeme für Wirtschaft und Forschung soll eine "persönliche Superintelligenz" entstehen – maßgeschneidert für den Alltag einzelner Menschen und neue Hardware.
Während viele Unternehmen an zentralisierten KI-Systemen arbeiten, die wirtschaftliche Prozesse automatisieren oder wissenschaftliche Probleme lösen sollen, verfolgt Meta einen anderen Ansatz. CEO Mark Zuckerberg sprach in einem Interview mit The Information darüber, dass sein Unternehmen auf eine „Personal Super Intelligence“ zielt – eine Form von Künstlicher Intelligenz, die Menschen im Alltag als individueller Begleiter unterstützen soll.
Die Idee ist nicht ganz neu, aber in dieser Konsequenz bislang selten formuliert worden: KI nicht nur als Werkzeug zur Effizienzsteigerung, sondern als persönlicher Assistent für alltägliche und auch soziale Bedürfnisse. „Wir wollen diese Technologie direkt in die Hände der Menschen legen“, sagte Zuckerberg. Es gehe um Anwendungen, die sich mit Kreativität, Beziehungen, Unterhaltung oder kulturellen Interessen beschäftigen – Dinge, die im Leben vieler Menschen wichtiger seien als reine Produktivität.
Wer künftig keine KI-Brille trägt, wird einen kognitiven Nachteil haben
Ein zentrales Element in Metas Vision ist die Integration dieser KI in Hardware, insbesondere in AR-Brillen. Zuckerberg skizzierte ein Zukunftsbild, in dem Menschen ihre Umgebung mit einer intelligenten Brille erleben: Die Brille sieht, was sie sehen, hört, was sie hören, und begleitet sie durch den Tag. Sie merkt sich Gesprächsinhalte, schlägt passende Informationen vor oder erinnert an vergessene Aufgaben. „Wer in Zukunft keine KI-Brille trägt, ist im Nachteil – ähnlich wie jemand, der heute keine Sehhilfe nutzt, obwohl er eine braucht“, so Zuckerberg.
Diese Brillen könnten laut Meta die bevorzugte Schnittstelle für KI-Anwendungen werden. Erste Produkte aus Metas Reality Labs sind bereits auf dem Markt, und Zuckerberg sieht darin eine strategische Brücke zwischen Hardware, KI und massenfähigen Produkten.
Rechenzentren in Zeltform
Die technischen Grundlagen für diese Vision entstehen derzeit in großem Maßstab. Meta investiert Milliarden in neue Rechenzentren mit einer Leistung von mehreren Gigawatt. Die bekanntesten Cluster tragen die Namen Hyperion und Prometheus – Anspielungen auf die griechische Mythologie.
Um schneller bauen zu können, verzichtet Meta auf klassische Betonbauten. Stattdessen entstehen wetterfeste Zeltkonstruktionen, in denen GPU-Cluster untergebracht werden. Hyperion soll in den kommenden Jahren auf bis zu fünf Gigawatt Leistung ausgebaut werden – eine Größenordnung, die laut Zuckerberg einem beträchtlichen Teil der Fläche Manhattans entspricht. Meta will damit die größte Compute-Flotte eines Unternehmens aufbauen.
Kapital aus dem eigenen Geschäft
Im Unterschied zu einigen Wettbewerbern kann Meta diese Investitionen aus eigener Kraft finanzieren. Das bestehende Geschäft mit Werbung und Plattformdiensten wirft laut Zuckerberg genug Kapital ab, um die Infrastruktur für Superintelligenz aufzubauen. „Wir haben die Mittel, um das zu tun – und das ist ein Vorteil“, sagte er. Andere Unternehmen müssten erst Kapital beschaffen, um vergleichbare Projekte zu stemmen.
Zuckerberg sieht darin auch eine strategische Möglichkeit: Wer frühzeitig massiv investiert, kann sich Vorteile in der Forschung und Produktentwicklung sichern. Zudem ermögliche Reinforcement Learning eine Verstärkung dieses Effekts – durch die Rückkopplung von Nutzererfahrungen in die Weiterentwicklung der KI-Modelle.
Produktentwicklung mit selbstlernenden Systemen
Erste Anwendungen der neuen KI-Strategie zeigen sich laut Zuckerberg bereits in bestehenden Produkten. Modelle auf Basis von Llama 4 hätten begonnen, interne Systeme wie den Facebook-Algorithmus zu verbessern – ohne direkte Eingriffe von außen. Dieser selbstoptimierende Effekt sei ein Vorgeschmack auf das, was in Zukunft möglich sei: KI-Systeme, die sich selbst verbessern und dabei helfen, neue Produkte schneller und effizienter zu entwickeln.
Auf die Frage, ob Llama hinter der Konkurrenz zurückliege, räumte Zuckerberg ein, dass sich das Feld schneller entwickle als erwartet.
Die schwache Performance von Llama 4 ist möglicherweise ein Grund für den aktuellen Strategiewechsel: Meta investiert massiv in Infrastruktur, stellt neue Teams zusammen und verpflichtet hochkarätige Forscherinnen und Forscher. Das Ziel: mit der nächsten Modellgeneration technologisch aufzuholen – oder sogar vorbeizuziehen. Die Superintelligence-Initiative soll dabei als Neuanfang dienen.
Rechenleistung statt Hierarchie
Berichte über Gehaltspakete im dreistelligen Millionenbereich für die Abwerbungen bei Apple, Google Deepmind und OpenAI kommentierte Zuckerberg zurückhaltend. Zwar sei der Markt umkämpft, aber im Verhältnis zu den Milliarden, die in Infrastruktur investiert werden, mache der Aufwand für Spitzenkräfte nur einen kleinen Teil aus.
Als Wettbewerbsvorteil sieht er dabei vor allem diese Infrastruktur: Statt großer Teams mit vielen Zuständigkeiten sollen kleine Gruppen mit maximaler Rechenleistung arbeiten. „Die besten Forscher wollen nicht viele Leute unter sich – sie wollen viele GPUs“, sagte Zuckerberg. In einer Zeit, in der einzelne KI-Forscherinnen und -Forscher weltweit stark gefragt sind, sei das ein wichtiges Argument.
Wann genau Superintelligenz tatsächlich erreicht wird, sei unklar. Zuckerberg hält eine Realisierung in zwei bis drei Jahren für möglich – auch wenn es fünf oder sieben Jahre dauern könnte. Entscheidend sei, sich jetzt so aufzustellen, als wäre die Technologie bald einsatzbereit. „Wenn man wirklich daran glaubt, muss man jetzt investieren“, sagte er.
„Personal Super Intelligence“ ist eine Wette auf die Zukunft
Wie Meta mit „Personal Super Intelligence“ konkret Geld verdienen will, ließ Zuckerberg offen. Zwar betonte er, dass das bestehende Kerngeschäft die nötigen Investitionen ermöglichen würde – etwa durch Werbeeinnahmen und Plattformdienste –, doch bleibt unklar, ob und wie sich die neuen KI-Produkte selbst refinanzieren sollen. Anders als bei klassischen Software-Abos oder Cloud-Diensten fehlen derzeit belastbare Modelle für den Verkauf persönlicher KI-Begleiter.
Zuckerberg deutete an, dass es nicht um Werbung gehen solle. Stattdessen könnten Nutzer für eine hochwertige, nicht werbefinanzierte KI-Erfahrung direkt bezahlen – ähnlich wie heute für ChatGPT-Plus. Ob Milliarden Nutzer weltweit dazu bereit sind, bleibt abzuwarten. Meta scheint jedenfalls darauf zu setzen, dass die künftige KI-Plattform – etwa in Form der intelligenten Brillen – neue Interaktionsformen schafft, aus denen sich langfristig auch neue Geschäftsmodelle ergeben. Bis dahin finanziert sich der Wettlauf um die Superintelligenz aus den Gewinnen der Gegenwart.
KI-News ohne Hype – von Menschen kuratiert
Mit dem THE‑DECODER‑Abo liest du werbefrei und wirst Teil unserer Community: Diskutiere im Kommentarsystem, erhalte unseren wöchentlichen KI‑Newsletter, 6× im Jahr den „KI Radar"‑Frontier‑Newsletter mit den neuesten Entwicklungen aus der Spitze der KI‑Forschung, bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro‑Events und Zugriff auf das komplette Archiv der letzten zehn Jahre.
Jetzt abonnierenKI-News ohne Hype
Von Menschen kuratiert.
- Mehr als 20 Prozent Launch-Rabatt.
- Lesen ohne Ablenkung – keine Google-Werbebanner.
- Zugang zum Kommentarsystem und Austausch mit der Community.
- Wöchentlicher KI-Newsletter.
- 6× jährlich: „KI Radar“ – Deep-Dives zu den wichtigsten KI-Themen.
- Bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro Online-Events.
- Zugang zum kompletten Archiv der letzten zehn Jahre.
- Die neuesten KI‑Infos von The Decoder – klar und auf den Punkt.