Forscher finden, dass KI bei vielen Aufgaben bereits besser ist als der Mensch
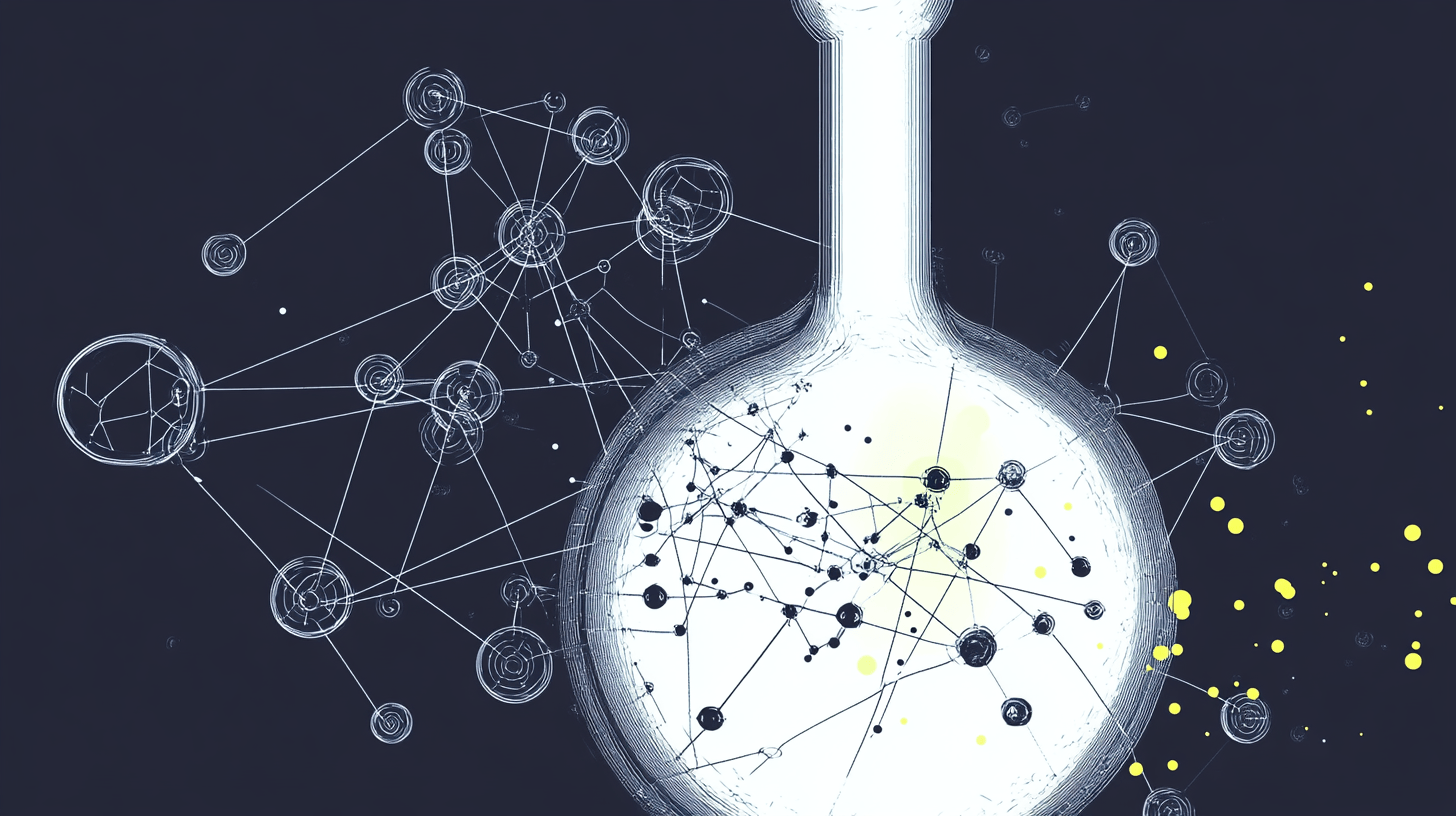
Eine große internationale Umfrage zeigt: Während Wissenschaftler das Potenzial von KI erkennen, behindern ethische Bedenken und Ängste vor Ungenauigkeiten den breiten Einsatz in der Forschung.
Laut einer neuen Umfrage des Wissenschaftsverlags Wiley (via Nature) unter fast 5.000 Forschern aus über 70 Ländern wird künstliche Intelligenz innerhalb der nächsten zwei Jahre zu einem festen Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit werden. Bereits jetzt sehen mehr als die Hälfte der Befragten KI in bestimmten Bereichen als leistungsfähiger an als Menschen.
Die Umfrage zeigt jedoch auch eine zurückhaltende Nutzung: Nur 45 Prozent der ersten 1,043 Befragten setzen KI-Tools tatsächlich in ihrer Forschung ein. Forscher aus China und Deutschland sowie Informatiker seien besonders aufgeschlossen gegenüber KI-Anwendungen in der Wissenschaft.
ChatGPT dominiert dabei das Feld: 81 Prozent der KI-nutzenden Forscher greifen auf OpenAIs Chatbot zurück. Andere Tools wie Googles Gemini oder Microsofts Copilot sind nur einem Drittel der Befragten bekannt.
Wenn KI zum Einsatz kommt, dann hauptsächlich für Übersetzungen, Korrekturlesen und die Bearbeitung von Manuskripten. Schreib- und Textaufgaben sind mit 57 Prozent die häufigste Anwendung, gefolgt von der Erkennung von Fehlern und Verzerrungen im eigenen Schreibprozess (47 Prozent).
Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet, dass verschiedene KI-Anwendungen innerhalb der nächsten zwei Jahre breite Zustimmung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft finden werden. Ein laut Studie für Nachwuchswissenschaftler beliebter Case ist, KI für das Verfassen von Förderanträgen und die Suche nach Kooperationspartnern einzusetzen.
Auch im Peer-Review-Prozess sehen die Wissenschaftler großes Potenzial: 51 Prozent erwarten, dass KI-basierte Empfehlungssysteme für Gutachter innerhalb von zwei Jahren zum Standard werden könnten.
Ethische Bedenken und Angst vor Fehlern hemmen den Einsatz von KI
Für Zurückhaltung beim KI-Einsatz sorgen ethische Überlegungen, die von 54 Prozent der Befragten genannt werden. Die zweithäufigste Sorge betrifft mögliche Ungenauigkeiten und Halluzinationen der KI-Systeme (51 Prozent). Datenschutzbedenken (47 Prozent) und mangelnde Transparenz der KI-Tools (46 Prozent) folgen dicht dahinter.
Trotz des großen Interesses an KI-Tools fehlt es den Forschern an Unterstützung: 43 Prozent der Befragten geben zudem an, dass ein Mangel an Training sie davon abhält, KI stärker zu nutzen. 42 Prozent fühlen sich schlicht mit der Fülle an Möglichkeiten überfordert.
Insgesamt bleibt die Sicherheit ein zentrales Anliegen: 81 Prozent der Befragten sind besorgt über die Genauigkeit der KI, mögliche Vorurteile, den Datenschutz und die Art und Weise, wie diese Systeme hinter verschlossenen Türen entwickelt werden.
KI soll dem Menschen in einigen Bereichen bereits überlegen sein
Nach Einschätzung der Wissenschaftler kann KI in bestimmten Bereichen bereits bessere Leistungen erbringen als Menschen. Bei der Manuskript-Vorbereitung sehen 62 Prozent der Befragten KI im Vorteil, insbesondere bei der Textverbesserung, Fehlererkennung, Plagiatsprüfung und Formatierung.
Auch bei der umfangreichen Informationsverarbeitung (60 Prozent) etwa bei vielen wissenschaftlichen Publikationen und der Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse (58 Prozent) durch Zusammenfassung oder Daten-Chats wird KI als überlegen eingeschätzt.
Obwohl 60 Prozent die automatische Verarbeitung unstrukturierter Daten als KI-Stärke sehen, nutzen nur 18 Prozent der Befragten diese Fähigkeit in der Praxis.
Bei der Erstellung von Lehrinhalten und multimedialen Materialien (51 Prozent), bei der Verbesserung von Forschungsmethoden und -kooperationen (58 Prozent) sowie beim Feedback und Peer-Review (59 Prozent) hat der Mensch nach Ansicht der befragten Forscher hingegen nach wie vor die Nase vorn. Speziell bei der Optimierung des experimentellen Designs und der Identifizierung potenzieller Kooperationspartner vertrauen die Forscher also weiterhin auf menschliche Expertise.
KI-News ohne Hype – von Menschen kuratiert
Mit dem THE‑DECODER‑Abo liest du werbefrei und wirst Teil unserer Community: Diskutiere im Kommentarsystem, erhalte unseren wöchentlichen KI‑Newsletter, 6× im Jahr den „KI Radar"‑Frontier‑Newsletter mit den neuesten Entwicklungen aus der Spitze der KI‑Forschung, bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro‑Events und Zugriff auf das komplette Archiv der letzten zehn Jahre.
Jetzt abonnierenKI-News ohne Hype
Von Menschen kuratiert.
- Mehr als 20 Prozent Launch-Rabatt.
- Lesen ohne Ablenkung – keine Google-Werbebanner.
- Zugang zum Kommentarsystem und Austausch mit der Community.
- Wöchentlicher KI-Newsletter.
- 6× jährlich: „KI Radar“ – Deep-Dives zu den wichtigsten KI-Themen.
- Bis zu 25 % Rabatt auf KI Pro Online-Events.
- Zugang zum kompletten Archiv der letzten zehn Jahre.
- Die neuesten KI‑Infos von The Decoder – klar und auf den Punkt.