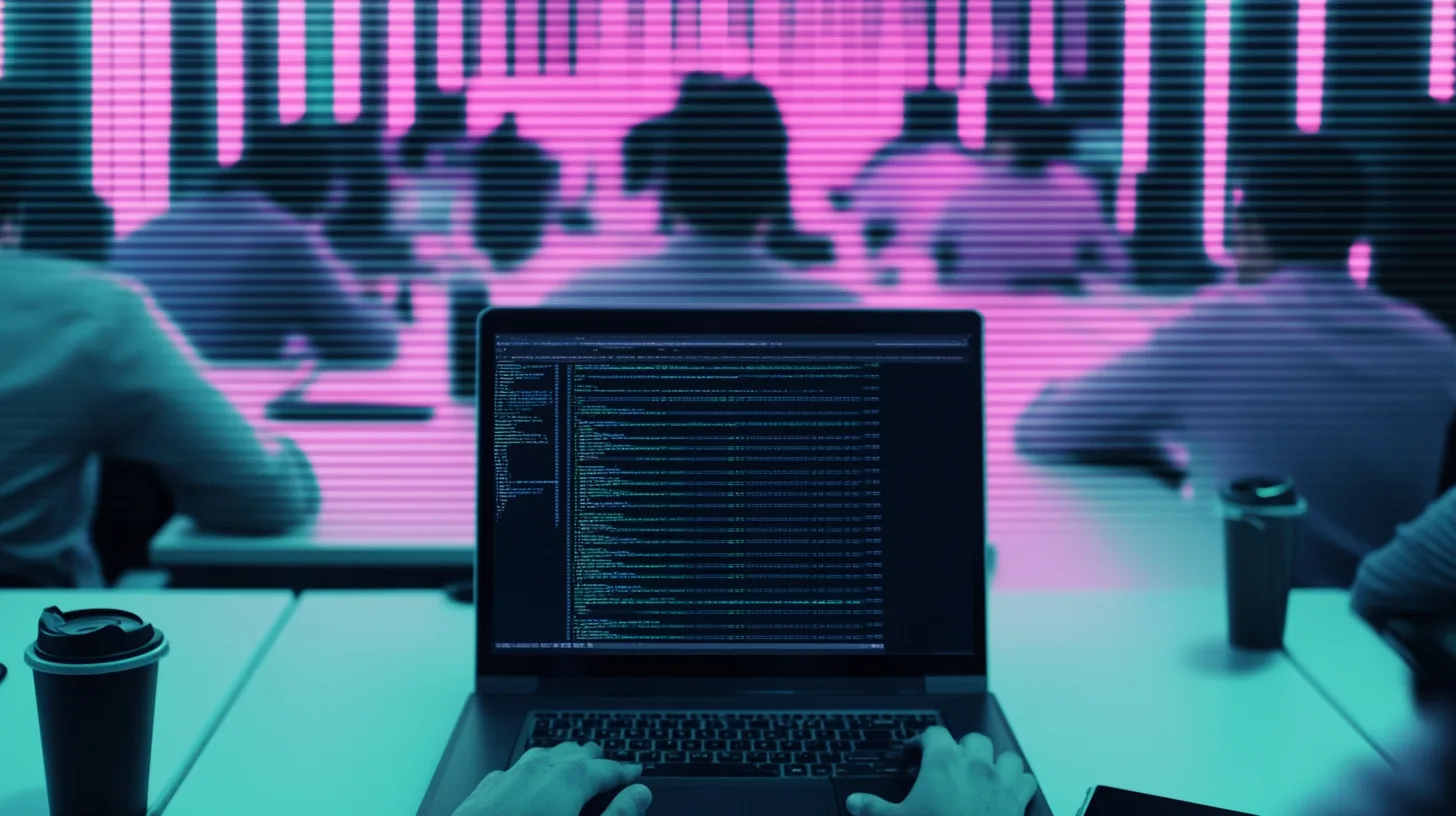Anthropic und der indische IT-Konzern Infosys entwickeln gemeinsam KI-Agenten für regulierte Branchen. Im Fokus stehen Telekommunikation, Finanzwesen, Fertigung und Softwareentwicklung. Die Agenten sollen eigenständig komplexe Aufgaben übernehmen – etwa Schadensfälle bearbeiten, Compliance-Prüfungen durchführen oder Netzwerkbetrieb bei Telekommunikationsanbietern automatisieren.
Dafür werden Anthropics Claude-Modelle mit Infosys Topaz kombiniert, einer KI-Plattform für Unternehmen. Anthropic-CEO Dario Amodei sagte, zwischen einer KI-Demo und dem Einsatz in regulierten Branchen liege eine große Lücke und Infosys bringe das nötige Branchenwissen mit, um diese zu schließen.
Indien ist laut Anthropic der zweitgrößte Markt für Claude. Infosys ist einer der ersten Partner von Anthropics neuem Büro in Bengaluru.